Es geht noch mehr - Ein Kompendium zur Digitalen Teilhabe speziell für Seniorenvertretungen
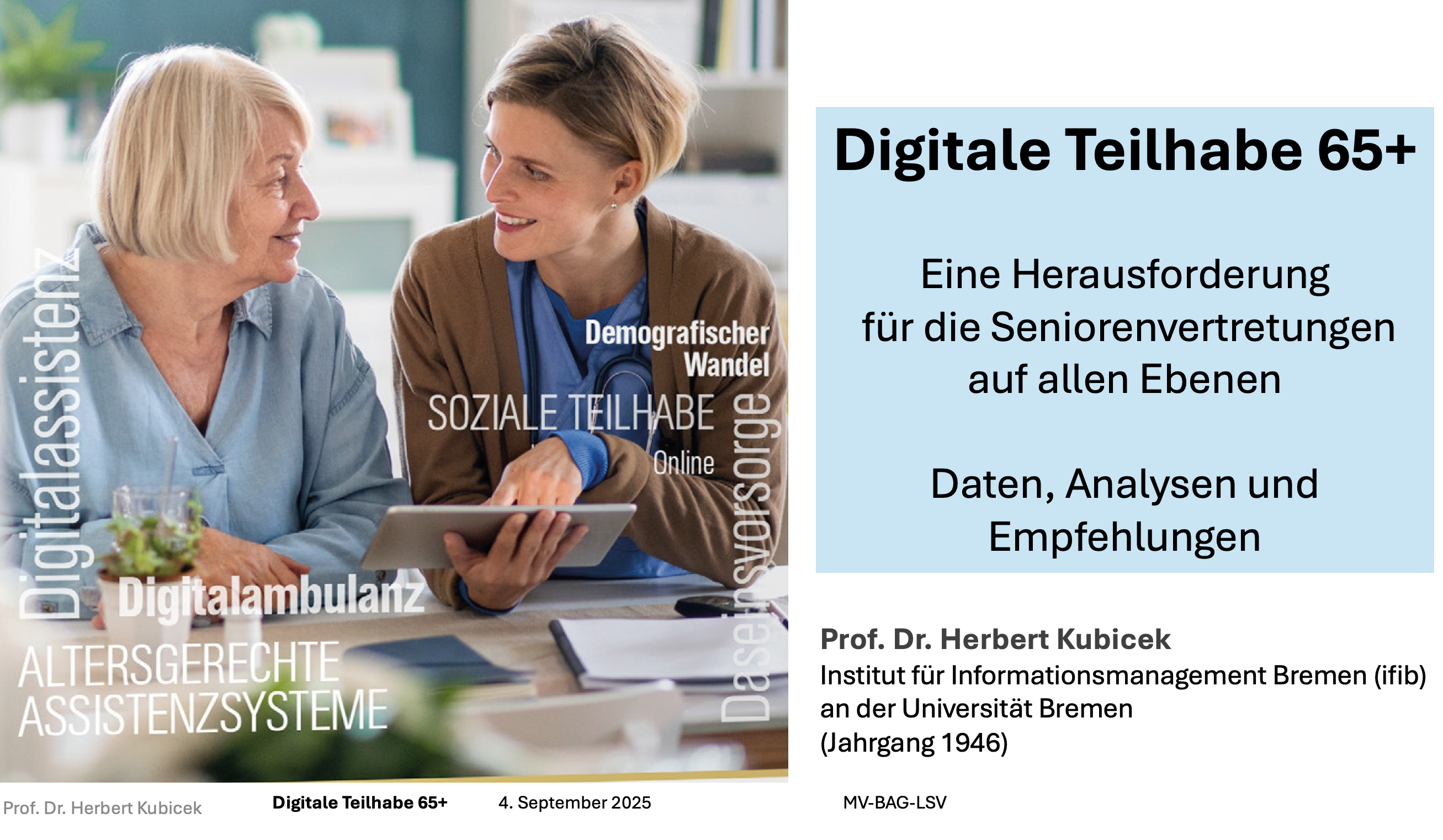
Hoffnung trotz zwei Enttäuschungen
In der vergangenen Woche habe ich einen Vortrag auf der Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen (BAG LSV) in Weimar zum Thema "Digitale Teilhabe im Alter als Herausforderung für die Seniorenvertretungen" gehalten. Mit großen Hoffnungen bin ich von Bremen nach Weimar gefahren, weil ich in den Seniorenvertretungen die politischen Akteure sehe, die am ehesten die Politik bewegen könnten, endlich ihre Versprechungen zur Digitalen Teilhabe einzulösen. Doch das scheint nicht so einfach zu sein, wie gleich zwei enttäuschende Erkenntnisse zeigen.
Zum einen gibt es anders als in Österreich auf Bundesebene bei uns keine mit formellen Rechten ausgestattete Seniorenvertretung, sondern nur eine Bundesarbeitsgemeinschaft, die sich aktuell noch nicht einmal eine Geschäftsstelle leisten kann, und auf der kommunalen Ebene hat die Mehrheit der Kommunen keine örtliche Vertretung der Seniorinnen und Senioren, weil das keine kommunale Pflichtaufgabe ist. Zum anderen musste ich die Hoffnung aufgeben, dass mit einer Novellierung der gesetzlichen Bestimmungen zur kommunalen Altenhilfe eine Pflicht zur Überwindung der Schwierigkeiten geschaffen werden kann, die ältere Menschen mit der Digitalisierung erleben. In ihrer Stellungnahme zum Neunten Altersbericht lehnt die alte Bundesregierung es komplett ab, die Leistungen nach §71 SGB XII zur Pflichtaufgabe zu machen, wie es die von ihr berufene Kommission für erforderlich hält, um die Strukturen der Altenhilfe bundesweit einheitlich und nachhaltig zu stärken, und verweist stattdessen auf die Bundesländer. Doch man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Auch angesichts der strukturellen Schwächen und der politischen Verweigerung glaube ich weiterhin, dass die Seniorenvertretungen auf Landesebene und vor allem auf der kommunalen Ebene mit Ausdauer auch ohne eine Novellierung des § 71 SGB XII Verbesserungen der Digitalen Teilhabe im Alter bewirken können. Mit diesem Kompendium von Daten, Analysen, Beispielen und Empfehlungen sowie einem Vorschlag für ein Auskunftsersuchen bei der lokalen Verwaltung und Politik möchte ich die wissensmäßigen Voraussetzungen dazu verbessern. Denn meine Erfahrung ist auch, dass viele schon länger tätige Seniorenvertreterinnen und -vertreter mit den konkreten Defiziten und erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Digitalen Teilhabe noch nicht hinreichend vertraut sind. Die Anfrage kann selbstverständlich auch jede andere Organisation und Initiative stellen, die sich vor Ort für die Belange älterer Menschen einsetzt
Mehr Druck erforderlich, damit sich was verbessert
Noch einmal: Ohne Druck kein Ruck - auch bei der Digitalen Teilhabe im Alter. In vielen Beiträgen habe ich Umfragen kommentiert, die belegen, dass es erhebliche Defizite bei der digitalen Teilhabe im Alter und deren bedarfsgerechter Unterstützung gibt. Das kann niemand übersehen. Aber die Politik in Bund und Ländern wiederholt seit Jahren vollmundige Versprechungen, dass bei der Digitalisierung alle mitgenommen und niemand ausgeschlossen oder zurückgelassen werden soll und - aktuell im Koalitionsvertrag - die digitale Teilhabe aller gewährleistet werde. Nur wird nie gesagt, wie das geschehen soll. Die Empfehlungen der von der vorherigen Bundesregierung zu diesem Thema eingesetzten Kommission für den Achten Altersbericht wurden ignoriert und die der Nachfolgekommission für den Neunten Altersbericht zur strukturellen Stärkung zurückgewiesen. Aus den negativen Befunden des bundesweiten Monitorings wurden und werden keine Konsequenzen gezogen. Aber ich sehe keine politischen Akteure, die auf diesen Widerspruch öffentlich hinweisen und endlich die Einlösung der wiederholten Versprechen mit Nachdruck einfordern. Das übliche Spiel von Regierung und Opposition funktioniert nicht, weil die Opposition von heute die Regierung von gestern ist, die auch nicht mehr getan hat. Die Sozialverbände kämpfen an vielen Fronten wie Altersarmut, Rente und Pflege und werden bezüglich Digitale Teilhabe im Alter mit vergleichsweise kleinen Pilotprojekten abgespeist.
Was können Seniorenvertretungen leisten?
Ich habe im Zusammenhang mit Veranstaltungen in Düsseldorf und Hannover unter Beteiligung der jeweiligen Landesseniorenvertretungen Empfehlungen für Forderungen auf Landesebene unterbreitet. Aber ist das die entscheidende Ebene? Wenn man bei Wikipedia nachschaut oder googelt, erfährt man, dass die Seniorenvertretung kommunal verankert ist. Schöning erläutert in einem Beitrag mit dem Titel "Seniorenvertretungen als kommunalpolitische Akteure", dass Seniorenvertretungen in den Kommunalverfassungen aller Bundesländer bis auf Berlin und Hamburg als freiwillige Aufgabe genannt werden, Städte und Kreise also selbst entscheiden können, ob und wie sie eine offizielle Seniorenvertretung schaffen und welche Rechte sie dieser einräumen. Meistens heißen sie Seniorenrat oder Seniorenbeirat oder Älterenvertretung, arbeiten ehrenamtlich, überkonfessionell und überparteilich. Mal werden die Mitglieder in Urwahl gewählt, mal vom Rat ernannt. Es gibt Auskunfts- und Beratungsrechte, Teilnahme- oder Antragsrechte im Rat, Anhörungsrechte bei seniorenrelevanten Planungen und Entscheidungen. Aber Beratungsrechte wirken nur so weit, wie es eindeutige Verantwortlichkeiten in der Verwaltung gibt und diese sich auch beraten lassen wollen. Beides ist nicht selbstverständlich. Vor allem aber hat mich überrascht, dass der Autor in diesem Beitrag aus 2019 schätzt, dass von den 11.000 Kommunen nur jede Achte überhaupt irgendeine offizielle Seniorenvertretung geschaffen hat. Die Tendenz sei steigend. Aber aktuellere Zahlen gibt es offenbar nicht.
Fokus auf den Ausführungsgesetzen der Länder zum § 71 SGB XII
Noch kurz zu dem Rechtsstreit über den § 71 SGB XII. Die Kommission für den Neunten Altersbericht hat in ihrem Bericht vom Januar 2025 Forderungen der BAGSO, des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. (DV) und anderer übernommen, mit einer Novellierung des § 71 der Altenhilfe in Deutschland eine verpflichtende, einheitliche und nachhaltige strukturelle Grundlage zu schaffen. Doch das lehnt die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zu dem Bericht entschieden ab:
“Soweit der Sachverständigenbericht den § 71 SGB XII jedoch als Grundlage der Altenhilfe in Deutschland einstuft, weist die Bundesregierung darauf hin, dass zwischen der kommunalen Altenhilfe als Teil der kommunalen Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG und der sozialhilferechtlichen Altenhilfe nach § 71 SGB XII zu unterscheiden ist. Letztere ist eine Fürsorgeleistung, ausgestaltet als eine Hilfe im Einzelfall. Sie soll dabei ohne Rücksicht auf vorhandenes Einkommen oder Vermögen geleistet werden, soweit im Einzelfall Beratung und Unterstützung erforderlich sind......... Die Bundesregierung begrüßt die Ermutigung der Sachverständigenkommission, die Altenhilfe durch landesgesetzliche Regelungen zu stärken (Empfehlung 24).“
Es ist rechtlich keineswegs sicher, dass der § 71 ausschließlich Einzelleistungen im individuellen Bedarfsfall betrifft und nicht auch infrastrukturelle Vorgaben macht (vgl. z.B. Sell 2025). Aber auch Ausdauer wird diese und zukünftige Bundesregierungen nicht davon abhalten, die Verantwortung für die Umsetzung des § 71 auf die Länder abzuwälzen. Die BAGSO hat das zitierte Positionspapier daher auch direkt an die Bundesländer adressiert und fordert von diesen sowohl strukturelle Änderungen auf Landeseben, wie z.B. eine fortzuschreibende Altenberichterstattung und Altenlandesplanung mit klaren Vorgaben für die kommunale Altenhilfe als auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung der Kommunen.
Was kann eine Bundesarbeitsgemeinschaft aktuell tun ?
Auf der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche hat der Vertreter von Berlin berichtet, dass noch im September mit dem lange angekündigten Entwurf der Senatsverwaltung für das Altenhilfestrukturgesetz zu rechnen ist. Berlin ist bisher das einzige Bundesland, das die Leistungen der Altenhilfe als Pflichtaufgaben für die Bezirke definiert. In den in Auftrag gegebenen Gutachten zur Konkretisierung der Pflichtleistungen kam die Digitale Teilhabe im Alter zwar noch nicht vor. Doch das soll sich im Gesetzentwurf geändert haben.
Ob andere Bundesländer diesem Beispiel aus eigenem Antrieb folgen, erscheint fraglich. Auch darf bezweifelt werden, ob sie von sich aus die Forderungen der BAGSO aufgreifen. Wenn einzelne Landesseniorenvertretungen dies tun, mag das in dem einen oder anderen Fall etwas bewegen. Eine sehr viel größere Chance sehe ich, wenn in der Bundesarbeitsgemeinschaft eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsorganisationen einen gemeinsamen Forderungskatalog erarbeitet, den diese in einer inhaltlich und zeitlich koordinierten Aktion den jeweiligen Landesregierungen übergeben. Das Beispiel Berlins in Verbindung mit dem Neunten Altersbericht und dem Positionspapier der BAGSO bietet dazu einen guten Anlass. Und vielleicht hilft ja auch die eine oder andere Anregung aus dem hier bereitgestellten Kompendium. Parallel kann der neue Vorstand die Landesvertretungen bitten, den ebenfalls bereitgestellten Entwurf für eine Anfrage zur Digitalen Teilhabe im Alter auf kommunaler Ebene an die kommunalen Vertretungen weiterzuleiten und die Antworten zurückzumelden, damit auf Landesebene ein aktuelles Lagebild gewonnen werden kann.

Absolut richtig! Digitale Teilhabe gehört zur Daseinsvorsorge – so steht es auch im Neunten Altersbericht. Bremen muss das Thema endlich verbindlich in den Ortsämtern verankern und koordinieren lassen. Sonst wird digitale Ausgrenzung zur neuen Form sozialer Ungleichheit!